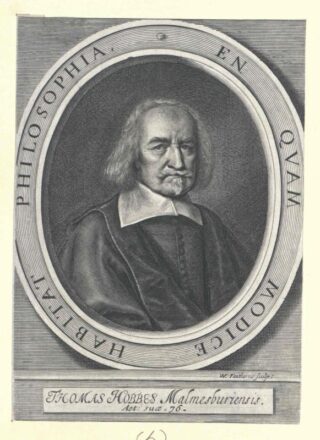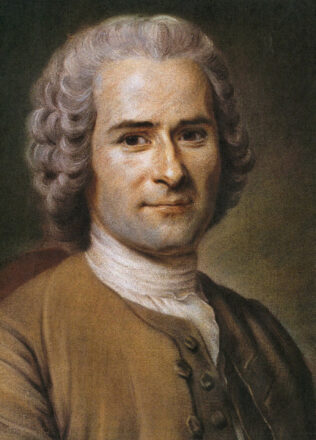Der Begriff Geschlechterdemokratie thematisiert einerseits die ungleichen Ausgangsbedingungen für Frauen und Männer in der westlich-liberalen Demokratie: Es gibt strukturelle Ungleichheiten in der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Erwerbsarbeit und Familien- und Betreuungsarbeit sowie in den Möglichkeiten politischer Gestaltung und Partizipation. Auch auf theoretischer und symbolischer Ebene sind demokratisches Verständnis und Praxis von ungleichen Geschlechterverhältnissen geprägt. Eine historisch in die politikwissenschaftliche Theoriegeschichte eingeschriebene männliche Sichtweise, die implizit das Individuum als Mann imaginiert (vgl. Rosenberger/Sauer 2004: 10; Ludwig/Sauer/Wöhl 2009: 14f), während zugleich weiblich konnotierte Eigenschaften abgewertet sowie weibliche Lebenszusammenhänge und Erfahrungen marginalisiert werden.
Geschlechterdemokratie formuliert andererseits aber auch den Anspruch gleichberechtigter Partizipation und Repräsentation aller Bürger*innen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung. Damit stellt Geschlechterdemokratie ebenso eine Art „politische Vision“ dar in Hinblick auf gleichberechtigte Möglichkeiten und Chancen in einer demokratischen Gesellschaft, das eigene Leben zu gestalten und in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu partizipieren (vgl. Rosenberger/Sauer 2004: 258; Holland-Cunz in Rosenberger/Sauer 2004: 144).
Männerdominanz in der Demokratie
Politik und Staat sind im Kontext ungleicher Geschlechterverhältnisse entstanden, die in der wissenschaftlichen und politischen Praxis reproduziert wurden und teilweise noch immer werden. Anders formuliert: Das politische System spiegelt die strukturelle Ungleichheit im Geschlechterverhältnis wider und trägt dazu bei, diese zu festigen. Es kommt zu einer Ungleichverteilung von Macht, die auf zwei Ebenen stattfindet: Auf Ebene der Repräsentation gibt es in den politischen Funktionen immer noch ein Ungleichgewicht. Vor allem in den Top-Positionen finden sich mehr Männer als Frauen. Und auch auf der inhaltlichen Ebene folgt politische Gestaltung tendenziell den Bedürfnissen einer männlichen erwerbszentrierten Biographie, die als geschlechtsneutraler Lebensentwurf dargestellt wird (vgl. Ludwig/Sauer/Wöhl, 2009: 16f; Rosenberger/Sauer, 2004: 10). Während die Politik samt der dazugehörigen Prozesse und Praxen weltweit (siehe hierzu auch Geschlechterverhältnisse im internationalen Vergleich) an einer männlichen Norm ausgerichtet ist, werden bestimmte Politikfelder wie insbesondere Familienpolitik als „weiblich“ kodiert (vgl. Kreisky in Rosenberger/Sauer 2004: 27). Auch damit wird die Zuordnung von Frauen zur häuslichen, reproduktiven familiären Sphäre reproduziert.
Der Geschlechtersubtext in der repräsentativen Demokratie
Demokratie bedeutet die Herrschaft des Volkes. Eine wichtige Eigenschaft demokratischer Systeme ist die Repräsentationsidee, also die Widerspiegelung der Anliegen des Staatsvolks im politischen System. Männer hatten historisch gesehen einen Vorsprung, ihre Interessen zu formulieren: Weltweit erhielten Frauen beispielsweise später das Wahlrecht als Männer, wobei hier erhebliche zeitliche Unterschiede ausgemacht werden können: Australien oder Finnland (damals russisches Großfürstentum) führten das Frauenwahlrecht zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1902 bzw. 1906) ein, viele Staaten folgten unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg – so auch Österreich, das 1918 Frauen das Recht zu wählen gewährte. In vielen afrikanischen Staaten erhielten Frauen das Recht zu wählen nach der Erlangung der Unabhängigkeit von den Kolonialmächten in den 1950er und 1960er Jahren. In der Schweiz wurde erst 1971 ein Frauenwahlrecht verabschiedet, in Liechtenstein gar erst 1984. In Saudi-Arabien durften Frauen 2015 das erste Mal an Wahlen teilnehmen (vgl. Gehlen 2015).
Der Gesellschaftsvertrag als Geschlechtervertrag: Demokratie als Androkratie?
Als Vertragstheorien gelten die im 17. und 18. Jahrhundert von Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau formulierten Überlegungen über mögliche Gesellschaftsordnungen. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf das moderne Verständnis von Staat, Staatsbürgerschaft und Politik und damit auf die moderne Gesellschaft ausgeübt. Da damit die theoretische Legitimierung der liberalen bürgerlichen Demokratie geschaffen wurde, sind sie fundamentale Klassiker der Politikwissenschaft. Sie werden auch als Gesellschaftsvertrag bezeichnet, da damit die ideellen Grundsteine für das gesellschaftliche Zusammenleben gleichberechtigter Staatsbürger*innen gelegt wurden und das Gewaltmonopol des Staates begründet wird: Die Bürger*innen treten ihre individuelle Gewaltfähigkeit freiwillig an den Staat ab und stehen im Gegenzug unter seinem Schutz – eine scheinbar geschlechtsunabhängige Grundlage für friedliches Zusammenleben. Die Politikwissenschafterin Carole Pateman hat jedoch 1988 mit ihrem einflussreichen Werk „The Sexual Contract“ (der Geschlechtervertrag) aufgezeigt, dass tatsächlich auch eine hierarchische Geschlechterordnung festgeschrieben wurde. Während die Vertragstheorien in der klassischen Rezeption als Geschichte der Freiheit gelesen werden, macht Pateman sie als Geschichte der Freiheit der Männer und als Grundlegung einer modernen patriarchalen Gesellschaftsordnung sichtbar (vgl. Pateman 1988: 2). Denn auch wenn nicht alle Vertragstheoretiker Frauen per se die Vernunftfähigkeit absprachen, haben sie alle vorausgesetzt, dass Frauen ihre individuellen Rechte an ihre Ehemänner, Väter oder Brüder abtreten. Da der Gesellschaftsvertrag eine fundamentale Grundlage moderner Gesellschaften darstellt, spricht Pateman von einem verheimlichten „Geschlechtervertrag“, der modernen Demokratien zugrunde liegt (vgl. Pateman, 1988: 1; zur Aktualität siehe Wilde in Ludwig/Sauer/Wöhl 2009).
Quellen
- Gehlen, Martin (2015): Saudi-Arabien entdeckt das Frauenwahlrecht. https://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/frauenwahlrecht-saudi-arabien-gleichberechtigung (12.04.2021).
- Ludwig, Gundula/Sauer, Birgit/Wöhl, Stefanie (2009) (Hg.): Staat und Geschlecht. Grundlagen und aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie. Baden-Baden: Nomos.
- Pateman, Carole (1988): The Sexual Contract. Oxford Polity Press.
- Rosenberger, Sieglinde K./Sauer, Birgit (2004) (Hg.): Politikwissenschaft und Geschlecht. Konzepte – Verknüpfungen – Perspektiven. Wien: UTB.