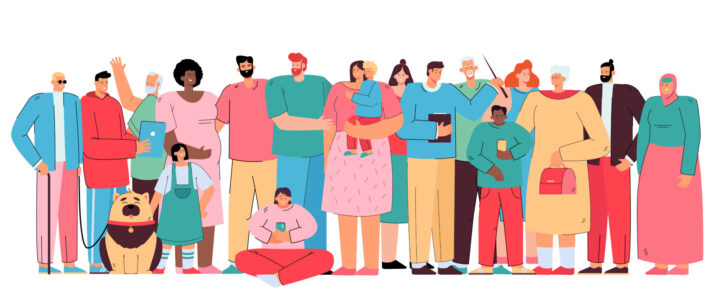In den Beziehungen von Männern und Frauen setzte in den 1960er und 1970er Jahren ein Wandel ein, „Partnerschaft“ war das neue Schlagwort, das die Beziehung nun bestimmen sollte. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann schlug sich auch auf rechtlicher Ebene nieder. Im Jahre 1975 kam es in Österreich zu einer grundlegenden Reform des Familienrechts. Das bis dahin geltende Familienrecht definierte den Mann als Haupt der Familie. Nach dem neu geschaffenen Familienrecht musste nun die Frau nicht mehr automatisch den Namen ihres Ehegatten tragen, sich für Haushalt und Familie allein zuständig fühlen oder den Ehemann um Erlaubnis bitten, wenn sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollte. Beide Ehepartner waren ab nun verpflichtet, zum Familienunterhalt beizutragen. Auch die Regelung der väterlichen Gewalt in der Familie wurde 1978 durch die gemeinsamen und gleichen Rechte und Pflichten von Eltern und Kindern ersetzt (vgl. Bauer 1995: 112).
Geschlechter, Beziehungen, Lebensformen
Inzwischen wird auch das Verständnis der Familie als Einheit von Mann, Frau und Kindern hinterfragt, und andere Formen des Zusammenlebens rücken zunehmend in den Blick von Politik und Legislative. Die Werte- und Moralvorstellungen haben sich in den europäischen post-modernen Gesellschaften der letzten 20 Jahre gewandelt, und unterschiedliche Lebensformen werden gesellschaftlich toleriert: Neben der Ehe und der Familie mit Kindern gibt es eine Vielzahl an Lebensformen wie Singles, Lebensgemeinschaften, Patchworkfamilien, Alleinerzieher*innen oder Geschiedene. Auch gleichgeschlechtliche Liebe sowie gleichgeschlechtliche Partner*innen- und Elternschaft ist inzwischen anerkannt und – beispielsweise durch das Recht auf Eheschließung seit 2019 – auch rechtlich verankert. Aus dem Bund fürs Leben wird mittlerweile bei über 40 Prozent eine „Ehe auf Zeit“ (vgl. Statistik Austria 2021a), gleichzeitig hat sich die Anzahl von Eheschließungen seit 1950 beinahe halbiert (vgl. Statistik Austria 2021b). Nachdem europaweit die Geburtenrate (Fertilitätsrate) von durchschnittlich 2,7 Kindern pro Frau im Jahre 1964 auf 1,4 Kinder pro Frau im Jahre 1999 gesunken war (vgl. Eurostat 2007: 68), stieg die Geburtenziffer 2019 auf 1,52 Kinder pro Frau (vgl. WKO 2021).
In Österreich lag die Geburtenrate in den letzten 10 Jahren zwischen 1,4 und 1,53 Kindern pro Frau. Seit 2016 sinkt sie leicht und lag 2019 bei 1,46. Mehr als 40 Prozent davon sind unehelich geboren (vgl. Statistik Austria 2021c).
Traditionelle Rollenbilder: nicht verschwunden
Trotz allen Fortschritts, was die geschlechterspezifischen Rollenzuschreibungen von Mann und Frau angeht, sind traditionelle Rollenbilder nach wie vor vorhanden. Zum einen innerhalb österreichischer konservativer Bevölkerungsgruppen, aber auch innerhalb patriarchal-traditionalistisch geprägter migrantischer Communities. Hier stoßen oftmals unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander: Individualismus an Stelle des großfamiliären Kollektivs und damit verbunden individuelle Lebensgestaltung anstatt kollektiver Kontrolle, die Gleichberechtigung der Geschlechter anstatt hierarchischer Strukturen (vgl. Libisch 2014: 29). Einen historischen Anknüpfungspunkt für die Wertvorstellungen innerhalb der türkisch-österreichischen Community beispielsweise stellt die Gastarbeitermigration dar: Viele Migrant*innen, die in den 1960er und 1970er-Jahren im Zuge dieser Migrationswelle eingewandert waren, wurden nicht als dauerhafte Einwohner*innen Österreichs begriffen. Die betreffenden Gruppen wurden in der Auseinandersetzung mit vorherrschenden Normen und Wertvorstellungen dadurch Großteils alleine gelassen, eine mangelnde Integrationspolitik tat ihr übriges (vgl. ebd.: 31). Während die Familien an ihren traditionellen Wertvorstellungen und Rollenbildern festhielten, haben junge Generationen oftmals eine „transkulturelle“ oder „bikulturelle“ Identität ausgebildet und ihre eigenen Wert- und Normvorstellungen entwickelt. Sie geraten dadurch einerseits in einen Generationenkonflikt – „andererseits ringen sie auch in der Mehrheitsgesellschaft um die Anerkennung und das Verständnis ihrer ‚eigenkulturellen‘ Identität“ (ebd.). Darauf reagieren sie oftmals mit der Überbetonung traditionalistischer Wertvorstellungen (vgl. ebd.), zu denen unter anderem auch patriarchale Rollenzuschreibungen – was beispielsweise Haushalt und Kinderbetreuung betrifft – gehören.
Kinderbetreuung = Frauensache?
Die Art der Arbeitsteilung im familiären Bereich spiegelt die tief verwurzelten Rollenzuschreibungen in der jeweiligen Gesellschaft wider. Dasselbe gilt für familien- und sozialpolitische Maßnahmen des Staates, beispielsweise bei der Frage der Kinderbetreuung: In Ländern, deren Gesellschaft eher von einem traditionellen Rollenbild geprägt ist, ist die staatliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung weniger institutionalisiert: Kinderbetreuung wird eher als private Familienangelegenheit und damit letztlich als Aufgabe der Mutter gewertet, in die sich der Staat nicht zu viel einmischen sollte. Diese Wertehaltung korrespondiert mit einer geringen Dichte an Kinderbetreuungseinrichtungen. Damit ist der Wiedereinstieg ins Berufsleben für den karenzierten Elternteil – zumeist die Mutter – schwieriger, da die Frage der Kinderbetreuung oft privat geregelt werden muss.
Ebenso ist die Höhe des Kinderbetreuungsgeldes ein wesentlicher Faktor: Ein Argument, warum Väter so selten Karenzzeiten in Anspruch nehmen, ist die Einkommensfrage: Da Männer in der Regel mehr verdienen als Frauen, trifft der Verlust des männlichen Einkommens das Familienbudget mehr als jenes des weiblichen. Im Falle eines einkommensunabhängigen Kinderbetreuungsgeldes gehen damit tendenziell eher die Mütter in Karenz. In Österreich gibt es seit 2017 zwei Varianten des Kindergeldes, davon eine einkommensabhängige Variante, die für maximal 14 Monate 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens als Kinderbetreuungsgeld vorsieht. Damit soll ein Anreiz für die Väterkarenz geschaffen werden. Ein weiterer Anreiz ist die Erhöhung der Bezugsdauer des Kindergeldes, bei Inanspruchnahme durch beide Elternteile.
Vaterschaft und Männlichkeit im Wandel
Mit der Veränderung traditioneller Geschlechterrollen, der Diversifizierung von Lebens- und Beziehungsformen wandeln sich auch die Vorstellungen von Männlichkeit und Vaterschaft. Bis in die 1980er waren Väter durch Abwesenheit im Familienleben gekennzeichnet, ihre Rolle war der Broterwerb. Das Verständnis von Elternschaft war geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich ausgeprägt: Während sie sich für Frauen „in der alltäglichen Praxis der Betreuung und Erziehung der Kinder“ (Meuser 2008) manifestierte, war Vaterschaft „primär ein sozialer Status, der durch die außerfamilialen beruflichen Aktivitäten gewonnen“ (ebd.) wurde. Mit dem Wandel der Geschlechterverhältnisse und Lebensrealitäten von Männern und Frauen ist teilweise auch eine wachsende Unsicherheit verbunden, was sich nicht zuletzt in neokonservativen, antifeministischen Bewegungen äußert, die eine Rückkehr zu – scheinbar stabilen und oft als „natürlich“ verklärten – traditionellen Geschlechterrollen fordern (zur antifeministischen Männerrechtsbewegung siehe Hinrich 2012). Während Vaterschaft heute zunehmend als aktive und engagierte Rolle gefasst wird, ist Männlichkeit mit teils ambivalenten gesellschaftlichen Vorstellungen verknüpft. „Das neue Verständnis von Vaterschaft muss in einen Identitätsentwurf integriert werden, der bei den meisten Männern am Leitbild einer hegemonialen Männlichkeit orientiert ist“ (Meuser 2008). Männer und Väter müssen sich damit zwischen traditionellen Rollenbildern von Familienoberhaupt und -ernährer und modernen, liberalen Identitäts- und Beziehungsvorstellungen kompatible Selbstbilder und Identitäten schaffen (vgl. Meuser 2008).